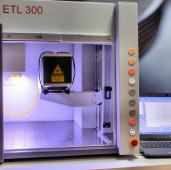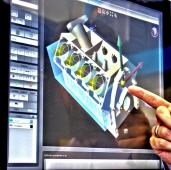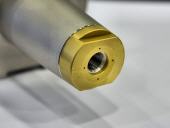Der Leistungsbilanzüberschuss
Ein Zeichen von Freiwilligkeit
Dass Deutschlands positiver Handelsüberschuss kein Ausdruck einer verfehlten Wirtschafts- und Finanzpolitik ist, erläutert Dr. Ralph Wiechers, Chefvolkswirt des VDMA.

Christine Lagarde, Donald Trump, Emmanuel Macron - mit schon ermüdender Regelmäßigkeit gerät Deutschland in die Kritik namhafter Politiker ob seiner Handels- und Leistungsbilanzüberschüsse. Der Vorwurf lautet: Der deutlich positive Saldo der deutschen Leistungsbilanz sei Ausdruck einer verfehlten Wirtschafts- und Finanzpolitik, die der Binnennachfrage zu wenig Aufmerksamkeit schenke. Die heimischen Kapazitäten würden auf Kosten anderer Länder ausgelastet, die wiederum keine ausreichende wirtschaftliche Eigendynamik entfalten können. Deutschland solle deshalb seine Politik grundlegend korrigieren und für eine höhere Lohn-und Einkommensdynamik, weniger Ersparnis und eine insgesamt höhere Binnennachfrage sorgen.
Richtig ist, dass Deutschland seit Jahren einen deutlich positiven Leistungsbilanzsaldo verzeichnet. Festzumachen ist das insbesondere am Warenhandel, also dem Überschuss der von Deutschland aus getätigten Exporte im Vergleich zu den Importen. Richtig ist auch, dass eine dauerhaft unausgeglichene Leistungsbilanz ein Zeichen für aus dem Gleichgewicht geratene außenwirtschaftliche Beziehungen ist. Während die Defizitländer in ein Finanzierungsproblem geraten, wenn sie dauerhaft über ihre Verhältnisse leben und sich dadurch gegenüber dem Ausland verschulden, laufen die Überschussländer Gefahr, dass ihre durch Leistungsbilanzüberschüsse erworbenen Auslandsvermögen keinen Ertrag mehr abwerfen und Wert verlieren. Ein ernst zu nehmendes Problem, denn immerhin geht bereits rund ein Drittel des deutschen Leistungsbilanzüberschusses zurück auf Erträge aus Kapital, das von deutschen Staatsbürgern im Ausland investiert wurde.
So wie grenzüberschreitende Investments auf dem Vertrauen beruhen, dass beide Seiten ihre eingegangenen Verpflichtungen dauerhaft erfüllen, beruht der internationale Tausch von Waren und Dienstleistungen gegen Geld letztlich auf Freiwilligkeit - und davon, dass sich beide Seiten von der Transaktion einen Vorteil versprechen. Die deutsche Industrie profitierte über Jahre vom großen Bedarf an Investitionsgütern rund um den Globus, während die nach wirtschaftlicher Eigenständigkeit strebenden Schwellen- und Entwicklungsländer eine leistungsfähige industrielle Infrastruktur aufbauen konnten und Kunden in bereits entwickelten Industrieländern ihre Maschinenparks modernisierten. Kurz: Die deutsche Industrie exportiert keine Probleme. Sie liefert Wettbewerbsfähigkeit. Mithilfe deutscher Lieferungen wachsen so neue Konkurrenten heran, und bestehende Wettbewerber rüsten auf. Je erfolgreicher aber diese Länder sich modernisieren, desto attraktiver wird es für deutsche Unternehmen, dort vor Ort zu investieren, zu produzieren und die lokale Nachfrage zu bedienen.
Einseitige Schuldzuweisungen sind folglich ökonomischer Unsinn - wenngleich politisch nachvollziehbar. Denn es geht hier um einen grundlegenden politischen Richtungsstreit. Der deutsche Finanzminister spart, während zahlreiche seiner Kollegen gern mehr ausgeben wollen, aber nicht können. Und dies ergänzend zur ohnehin expansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Gerade hier aber liegt eine wesentliche Ursache für die Exportstärke der deutschen Industrie: Durch den schwachen Euro gewinnt sie an preislicher Wettbewerbsfähigkeit. Kunden im Nicht-Euro-Raum müssen in heimischer Währung weniger für deutsche Produkte zahlen. Von diesem Vorteil können zwar auch andere Euro-Mitgliedsländer profitieren - vorausgesetzt, sie sind gut vernetzt mit ihren Kunden und verfügen über ein technologisch attraktives, wettbewerbsfähiges Angebot.
Und genau hier liegt der Haken: Exportstarke Unternehmen in Deutschland, darunter die Maschinenbauer, sind vor allem deshalb so erfolgreich, weil sie hervorragend auf den Weltmärkten positioniert sind und mit innovativen Produkten überzeugen. Hinzu kommen Kooperationsvorteile am heimischen Standort, ein enges Netz von langjährig erfolgreichen Zuliefer- und Abnehmerbeziehungen und damit ein hoher Selbstversorgungsgrad der deutschen Wirtschaft. Diese Wettbewerbsfähigkeit im In- wie im Ausland ist hart erkämpft - auch politisch mit teils sehr schmerzhaften Reformen. Reformen, die andere Länder offenbar gescheut oder nicht konsequent genug umgesetzt haben. Sei es, weil sie wie Frankreich mit einer staatlich gelenkten Industriepolitik schon über viele Jahre andere politische Konzepte verfolgen. Sei es, weil sie auf andere Wachstumsmodelle gesetzt haben wie die USA mit ihrer Hinwendung zum Dienstleistungssektor und ihrer Ausrichtung auf den oft nur kurzfristigen Erfolg.
Können sich die wirtschaftlich und politisch Verantwortlichen in Deutschland also beruhigt zurücklehnen? Mitnichten! Denn bei allen Erfolgen auf den Weltmärkten trägt die zu schwache inländische Investitionstätigkeit spürbar zur Unwucht der Leistungsbilanz bei. Die Zurückhaltung privater Investoren ist ein klares Indiz dafür, dass mehr getan werden kann und muss, um durch eine erhöhte Binnennachfrage auch den deutschen Leistungsbilanzüberschuss zu reduzieren. Noch offensichtlicher ist der Handlungsbedarf bei den staatlichen Investitionen in die öffentliche Infrastruktur – Straßen, Brücken, aber auch digitale Netze und nicht zuletzt Forschung und Bildung. Eine gute Infrastruktur ist unverzichtbar für erfolgreiches Wirken im eigenen Land. Kaum ein deutscher Hersteller von Investitionsgütern wird sich der dadurch generierten heimischen Nachfrage widersetzen – im Gegenteil! Das Geschäft vor der eigenen Haustür ist immer gern gesehen.
Mehr Informationen zum VDMA:
 |
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. |
 |
Lyoner Strasse 18 |
 |
60528 Frankfurt/Main |
 |
Postfach 71 08 64, 60498 Frankfurt/Main |
 |
Telefon +49 69 6603 0 |
 |
Fax +49 69 6603-1511 |
 |
E-Mail: Kommunikation@vdma.org |
 |
www.vdma.org |
War dieser Artikel für Sie hilfreich?
 |
 |
 |
 |
 |
Bitte bewerten Sie diese Seite durch Klick auf die Symbole.
Zugriffe heute: 2 - gesamt: 4652.